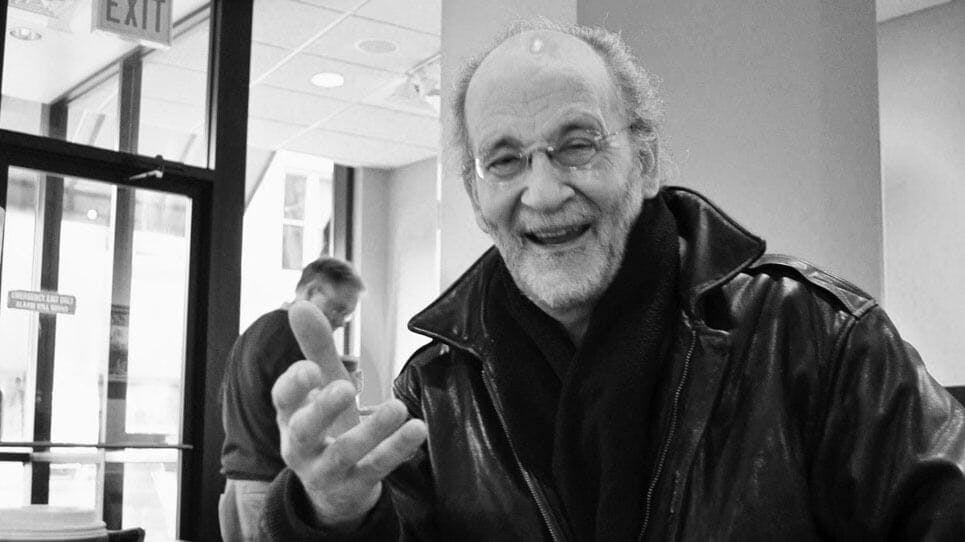
Moishe Postone – ein Nachruf
Ich hatte von Moishe Postone bereits gehört, lange bevor ich sein Schülerin wurde. Der marxistische Professor, so wurde mir gesagt, war einer der Ideengeber einer kleinen, aber einflussreichen Strömung innerhalb der deutschen Linken, die sich „Antideutsche“ nennt. Eine Strömung, der es – wie der Name bereits anzudeuten scheint – darum geht, ihr „Deutschsein“ abzulegen und im Rahmen bedingungsloser Solidarität mit dem Staat Israel den Antisemitismus zu bekämpfen. Ich weiß nicht mehr, wer mich zuerst auf diese Gruppierung aufmerksam machte. Vielleicht einer der deutschen Aktivist*innen, die sich zu Beginn der 2000er Jahre an palästinensischen Demonstrationen gegen die Mauer beteiligten, an denen ich ebenfalls teilnahm. Vielleicht war es aber auch einer meiner israelischen Bekannten, die etwa zu jener Zeit von Tel Aviv nach Berlin zogen und in der dortigen aktivistischen Szene unterkamen. So oder so erschien mir – aber auch vielen in meinem Umfeld – dieses Phänomen der „selbsthassenden Deutschen“ als eine Kuriosität, die Hohn und Spott verdiente - eine weitere Form der „deutschen Schuld“, die wohlmeinende Linke dazu führte, die Realitäten im heutigen Israel und der Besatzung nicht erkennen zu können. Wir gingen davon aus, dass uns israelischen Aktivist*innen aufgrund unserer authentischen Perspektive die Rolle zufiel, die Antideutschen aus ihrem neurotischen Dornröschenschlaf zu wecken und sie mit der Art von Legitimität zu versehen, die Deutsche benötigen, um über Israel sprechen zu können – eine Art "Koscher"-Gütesiegel, ausgestellt von einer Gruppe von Juden (wie politisch unbedeutend sie auch sein mag).
Und da die israelische Linke, besonders im Gewand ihrer ausufernden NGO-Szene, einen bedeutenden Teil ihrer Finanzierung von parteinahen deutschen Stiftungen erhält, gab es viele Fälle, in denen unsere Haltung politisch relevant erschien, zumindest uns. Von Zeit zu Zeit wurden wir von unseren Partner*innen in Deutschland gebeten, unsere Stimme zu erheben für eine „konsequentere“ Haltung der deutschen Linke zur israelischen Politik. Darüber hinaus wurden wir – neben palästinensischen Aktivist*innen und Akademiker*innen – auch zu Workshops mit deutschen Aktivist*innen eingeladen, die – so schien es uns – kurz vor der Bekehrung standen. Aufgrund unseres umfassenden Wissens um postkoloniale Kritik wären wir in der Lage, die Reihe von Verschiebungen zu erkennen, die den Zionismus als Lösung zum Antisemitismus erscheinen ließ, und nicht etwa als das, was er wirklich ist: eine Bestätigung der Auffassung, dass Juden keinen Platz in Europa haben und eine Verlängerung der Praxis, Juden in rein jüdische Gebieten zu sperren.
Das war mehr oder weniger meine Haltung, als ich 2012 nach Chicago ging, um dort meinen Doktortitel in Anthropologie zu erwerben. Ich ging nicht nach Chicago, um bei Moishe Postone zu lernen, wie es viele Studierende berechtigterweise taten. Da ich jedoch ein großes Verlangen danach hatte, Hegel und Marx zu lesen, meldete ich mich schnell für Postones jährliches Kolloquium an. Ich wusste, dass unsere politischen Ansichten – zumindest was Israel betraf – nicht gerade auf einer Linie waren, aber das hinderte mich nicht daran bei einem der führenden marxistischen Denker*innen zu studieren. Ohnehin dachte ich mir in meiner arroganten Haltung: Sollte es nicht vielleicht möglich sein, den Professor davon zu überzeugen, dass zumindest manche seiner Ansichten veraltet waren und keine angemessene Antwort mehr auf die aktuellen Realitäten der Kolonisierung Palästinas bildeten?
Und so begann meine Beziehung zu Moishe, zu gleichen Teilen geprägt von Ehrfurcht und Rebellion. Ich nahm mir vor, eine versierte Schülerin der marxistischen Methode zu werden, die er beim Lesen des ersten Bands des Kapitals so brillant herausarbeitete. Zugleich, und später auch als seine Lehrassistentin, führte ich mit ihm tiefgründige politische Debatten und hitzige Diskussionen über den Kampf bei uns »Daheim«. Moishe, das sollte vielleicht erwähnt werden, war im Allgemeinen für Gespräche offen. Viele seiner langjährigen Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen an der Universität Chicago, mit denen er über Politik diskutiert hatte, etwa Rashid Khalidi oder Jean und John Comaroff, hatten dem Campus vor Kurzem den Rücken gekehrt. Und obgleich er dank der liberalen israelischen Tageszeitung Haaretz auf dem Laufenden blieb, war er stets begierig mehr zu erfahren, besonders was die politische Ökonomie der Besatzung und den (desolaten) Zustand der israelischen Linken anging.

Moishe war generell der Überzeugung, dass die israelische Linke, ebenso wie ihre Entsprechungen anderswo auf der Welt, unter der Krankheit des „Hyper-Subjektivismus“ litt, was manchmal auch als Identitätspolitik bezeichnet wird. Nicht jedoch in dem gewöhnlichen Sinn, in dem konventionelle Marxist*innen diesen Begriff nutzen, um jeden Kampf gegen Unterdrückungsformen zu verunglimpfen, der nicht auf der Kategorie der Klasse basiert. Diese Art von Kritik setzte in seinen Augen Klasse einfach nur als politische Identität voraus, scheiterte aber daran, die strukturellen – „quasi-objektiven“ – Kräfte zu analysieren, die den Kapitalismus „hinter dem Rücken“ der sozialen Akteur*innen reproduzieren. Moishe war dagegen der Meinung, das Dilemma der Linken sei während des Großteils des 20. Jahrhunderts in dem begründet gewesen, was er „ein fetischistisches Verständnis der globalen Entwicklung“ nannte, also „ein konkretistisches Verständnis abstrakter historischer Prozesse, das diese als politisch und durch menschliches Handeln bestimmt begreift“ (Postone 2006, 96).
Um besser verstehen zu können, warum der Antisemitismus in Postones Denken eine so zentrale Rolle eingenommen hat, sind weiterführende Ausführungen vonnöten. Kurz gefasst ließe sich sagen, dass Postones Lesart von Marx die Einschränkungen betont, die die Verwertungsdynamik, als Herzstück des Kapitalismus, der Freiheit und damit auch der politischen Handlungsfähigkeit auferlegt. Aus seiner Sicht ist der Kapitalismus eine ganz eigene, historisch-spezifische Lebensform, in der Herrschaft eine Gestalt annimmt, die überwiegend nicht subjektiv ist, also nicht auf den schlechten Absichten der herrschenden Klassen als solcher beruht. Was auch immer diese „personae dramatis“ (so Marx [MEW 23, S. 125]) von sich selbst denken mögen, sie sind ebenso wie ihre Arbeiter*innen gezwungen zu tun, was sie tun, wenn sie bleiben wollen, wer sie sind.
Demnach bestimmt der moderne Kapitalismus nicht nur die Institutionen, die unser Leben strukturieren, sondern auch die Art und Weise, wie wir über diese denken. Wir können daher nicht mit dem Kapitalismus brechen, indem wir auf eine externe Realität rekurrieren, die von den Lebens- und Denkbedingungen entkoppelt ist, in die wir eingebettet sind. Jeder Versuch, unsere Realität von „außen“ zu kritisieren, wie etwa der Rückgriff auf Widerstandslogiken, die vom System bislang nicht vereinnahmt worden sind, wird erzwungenermaßen und auf unreflektierte Weise jenen Gegensatz reproduzieren, der das Kapital in Bewegung hält: den zwischen der konkreten Warenform (materiell, „real“ und unvermittelt) und der abstrakten (symbolisch, sozial und vermittelt). Die damit einhergehende Verkennung von Kapital mit einer bestimmten Person oder Personengruppe, stellt eine Art von einem „konkretisierten“ Denken dar, das eine Seite der Fetischform irrtümlicherweise als Auflösung der gesamten Antinomie begreift.
In diesem Sinne stimmte Postones Lesart von Marx auch nicht mit marxistischen Theorien überein, die eine „reale“ proletarische Arbeit betonen und diese als Kraft definieren, die in der Lage sei, den eisernen Käfig der Bürokratie aufzubrechen. Für ihn war das nichts weiter als die Umkehrung des ebenfalls irrgeleiteten liberalen Glaubens an einen vollkommen universellen Hegelschen Staat, in dem alles Partikulare und jegliche Differenz aufgehoben sind. Wie der Kapitalismus nicht nur unsere subjektiven Identifizierungen prägt, sondern infolgedessen sogar die Form, in der wir unseren Widerstand gegen seine Herrschaft zum Ausdruck bringen, stellte auch den Kern von Postones Antisemitismus-Kritik.
Postone verstand die nationalsozialistische Ideologie nicht nur als Reaktion auf die Moderne – ob in Form einer Rückkehr zur urwüchsigen Gemeinschaft oder in der überzogenen Umsetzung einer rationalen Bürokratisierung –, sondern als historisch-spezifische (Fehl-)Identifikation der Juden als „wirkliche Kraft“, die verschwörerisch hinter den unverständlichen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen stecke. Indem diese Ideologie die Fetischform reproduzierte, lehnte sie die Moderne nicht rundweg ab. Sie begrüßte vielmehr, was sie als die „realen“ und „materiellen“ Eigenschaften der deutschen Arbeit und Industrie begriff, und verstand sich selbst als emanzipatorische, ja sogar revolutionäre Kraft, die die arische Rasse von der abstrakten Herrschaft jenes parasitären Kapitals befreien sollte, das in der Figur des Juden verkörpert wurde.
In diesem Sinne war Postone der Meinung, dass die Nazi-Ideologie nicht in erster Linie mit anderen Formen des Rassismus zu vergleichen sei, die ihren Objekten konkrete Machtformen zuschreiben (seien diese materiellen oder sexuellen Charakters). Eher sei diese Ideologie zu vergleichen mit Gesellschaftstheorien, die den Kapitalismus mit Abstraktion gleichsetzen und dadurch gegen ihn vorzugehen versuchen, dass sie die als ontologisch vorrangig angesehene Aktualität des materiellen, natürlichen und konkreten Lebens bejahen.
Postone war der Überzeugung, dass die dominante Ideologie in Westdeutschland nach 1945 die grundlegende Beziehung zwischen dem Antisemitismus und dem Nationalsozialismus verschleierte. Indem sie die Vernichtung der europäischen Juden von den sozialen und politischen Bedingungen trennte, die diese erst ermöglicht hatten, konnte ein radikaler Bruch mit der Nazi-Vergangenheit postuliert werden. Die deutsche Linke wiederum neigte dazu, den terroristischen und hochgradig bürokratisierten Charakter des Nazi-Regimes als eine übersteigerte Form des „herkömmlichen Kapitalismus“ zu deuten. Beide Formen der Analyse, so Postone, versuchten der historischen Spezifität des Holocaust dadurch zu entrinnen, dass sie die Ideologie der Nazis von ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit trennten. Letztere wurden nicht im Kontext der sozialen und politischen Realität Deutschlands verstanden, sondern entweder als Resultat allgemein menschlicher Neigungen (Rassismus als Sündenbock-Denken oder als kollektive Psychose) oder als reflexhafte Reaktion auf einen verallgemeinerten Zustand übersteigerter Repression, faschistischen Terrors oder des Patriarchats im Allgemeinen. Dass diese Theorien an ihrem Gegenstand scheiterten war, so Postones Schlussfolgerung, Ausdruck davon, dass die Gesellschaftstheorie selbst zu einer „Form der psychischen Repression“ geworden war, entsprechend dem Bedürfnis, die eigene Schuld zu leugnen und der schrecklichen Erfahrung von Scham, Reue und Angst vor Vergeltung zu entgehen (1980: 100).
Postone zufolge stellte der Krieg von 1967, aus dem Israel als Sieger hervorging, für Teile der Neuen Linken in Deutschland eine weitere Gelegenheit dar, falsche Identifikationsmuster auf soziale und politische Analysen zu projizieren. Postone beschrieb die Kehrtwenden junger deutscher Linker, die Zionismus mit Nazismus gleichsetzten und die Palästinenser*innen zu den „echten Opfern“ oder sogar „echten Juden“ erklärten. In dieser Wahrnehmung bewiesen die Palästinenser*innen ihre Überlegenheit gegenüber den Quasi-Juden (das heißt den wirklichen, historischen Jüdinnen und Juden), indem sie sich gegen ihre Unterdrücker*innen zur Wehr setzten. In diesem Sinne nimmt Postones Antisemitismus-Theorie in der Tat so manche zeitgenössische Kritik vorweg, die davon spricht, die „Judenfrage“ sei in neuem Gewand zurückgekehrt.
Wie unter anderem Robert Meister und Bruno Chaouat überzeugend nachgewiesen haben, war der Westen in der Nachkriegszeit bestrebt, den Holocaust als Maßstab zu universalisieren, an dem jegliche Gräueltat zu messen sei; auch die Situation der Juden wurde im Sinne einer allgemeinen Opferrolle universalisiert. Im Rahmen dieser neo-paulinischen Botschaft hatte die eigene historische Erfahrung der europäischen Juden sich hintanzustellen – zugunsten einer Botschaft für die gesamte Menschheit. Die Jüdinnen und Juden wurden aufgefordert, alle Formen von Partikularismus abzulegen und zu einer universalen ethischen Gemeinschaft zu werden. Das einzige Problem bestand darin, dass die Juden die einzigen waren, die „das Memo nicht bekommen hatten“. Und wieder einmal weigerten sich Juden, nach der Ankunft Christi zu Christ*innen zu werden.
Postones Weigerung, den Zionismus mit Faschismus und Kolonialismus in einen Topf zu werfen und ihn stattdessen als eine Form des Nationalismus unter anderen zu begreifen, hat ihm unter jenen deutschen Linken, die sich Antideutsche nennen, einen guten Ruf eingebracht. Diese scheinen nämlich zu glauben, dass seine Theorie eine unerschütterliche Solidarität mit Israel und seiner Politik rechtfertigt. Postones Gedanken über die komplexen Zusammenhänge politischer Identifikation lassen sich aber auch für eine Kritik jener Israel-Unterstützer*innen in Stellung bringen, die geistigen Trost in einer projektiven Identifikation mit den Juden suchen und sich dabei nicht völlig von jenen Deutschen unterscheiden, die von sich behaupten, „die wahren Opfer“ des Nationalsozialismus zu sein. Auch die von den Antideutschen vorgenommene, projektive Identifikation mit den („wahren“) Juden kann als Versuch gesehen werden, Schuld von sich zu weisen, die Angst vor Vergeltung zu mildern und die Notwendigkeit zu verleugnen, sich den sozialen Verhältnissen zu stellen und auf deren Transformation hinzuarbeiten.
Postone war sicherlich kein Anti-Zionist, und zwar vor allem deswegen, weil er keinen Grund sah, warum in einer in Nationalstaaten aufgeteilten Welt den Juden das Recht auf Selbstbestimmung verweigert werden sollte. Gleichzeitig war er weit davon entfernt, Israel zu idealisieren, sei es in der Form, die dieser Staat vor 1967 annahm, also vor der Besatzung der Palästinensergebiete, sei es in der, die er danach annahm. Meiner Meinung nach sah Postone den Zionismus auch nicht als Lösung für das jüdische Problem an sich an. Vielmehr betrachtete er den Zionismus, mit seiner Entscheidung für Nationalismus und Partikularismus als eine Verzerrung und Verfälschung der jüdischen Tradition, in dem gerade die andauernde Abwägung von Partikularismus und Universalismus so zentral war. Er sah nicht ein, dass sich die Spannung zwischen den beiden Polen einfach dadurch auflösen lässt, dass man sich für die eine Seite entscheidet. Eher glaubte er an die Wirkung einer vorsichtig die eigenen Möglichkeiten und Spielräume reflektierende Vermittlung. In einem frühen Artikel schrieb er dazu: „Die Juden waren niemals Teil der umfassenderen Gesellschaften, in denen sie lebten; sie waren auch niemals völlig losgelöst von diesen Gesellschaften. Die Folgen waren für die Juden häufig desaströs. Zuweilen waren sie auch fruchtbar […]. Die endgültige Auflösung dieser Spannung zwischen dem Partikularen und dem Universalen ist, in der jüdischen Tradition, eine Frage der Zeit, der Geschichte – das Kommen des Messias.“ (Nationalsozialismus und Antisemitismus 1979). Postone war der Überzeugung, dass das, was in Europa zwischen 1933 und 1945 unwiederbringlich zerstört wurde, eine ganze Kultur war, eine historische Lebensweise, die weder zurückgebracht noch wiederhergestellt werden kann. Eine unverbrüchliche Treue zu dieser Kultur durchdringt Postones Gesamtwerk und hat auch seine Entscheidung bestimmt, als praktizierender Jude zu leben.
Aus meiner Sicht kann Postones warnende Erzählung von großer Bedeutung nicht nur für die Linke in Deutschland, sondern auch für die Linke in Israel sein. Sie mahnt uns zu reflektieren, wie ein verwerfliches Regime dadurch weiter ernährt wird, dass linke Kritik sich nicht seiner Verflechtung in einem Gewebe projektiver Identifikationen bewusst wird. Denn selbst eine rudimentäre Analyse der Wirkung der Zweiten Intifada auf die israelische Linke würde zeigen, dass es zu einer bezeichnenden Spaltung kam: Zum einen jene „desillusionierten“ Liberalen, für die die Palästinenser*innen mit der Aufnahme des bewaffneten Kampfes endlich „ihr wahres (böses) Gesicht gezeigt haben“, was „uns“ (Israelis) dazu zwingt, für immer und ewig die Waffen bereitzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir die radikale Linke, die dem idealisierten Bild eines „guten Palästinensers“ verfallen ist: Eines Opfers, das stets nach Gerechtigkeit strebt, nie jedoch nach Rache.
Natürlich haben beide Bilder herzlich wenig mit den komplexen Realitäten des palästinensischen Widerstands gemein. Sie sind ebenfalls nicht in der Lage zu begreifen, wie die israelische Politik und ihr stetig wachsender Sicherheitsapparat, der von Zeit zu Zeit in Form sinnloser und überzogener Gewaltspektakel ausbricht, auf ähnlichen Mechanismen der Verleugnung, der Scham und der Angst basiert. Auch wir als Teil der israelischen Linken vermögen nicht zu erkennen, dass Israels unausgesprochenes Wissen um die eigene Gewalt zu einer Kraft geworden ist, die das Gemeinwesen in Form grotesker Phantasien und Alpträumen bevorstehender Rache heimsucht. Solche projektiven Phantasien zwingen Israel gewissermaßen zur kontinuierlichen Ausübung „präventiver“ Gewalt, die sich mit jeder neuerlichen Anwendung exponentiell, ja sogar geometrisch steigern muss.
Gerade deshalb muss die israelische Linke den Mut aufbringen, sich ihren eigenen projektiven Identifikationen zu stellen und womöglich die pseudo-universalistische Haltung ablegen müssen, die wir üblicherweise unserer eigenen Gesellschaft gegenüber einnehmen. Diese Haltung lässt sich leicht auf unsere Lebensverhältnisse als Teil einer mobilen und globalen Elite zurückführen, die überall leben kann (und tatsächlich auch „global“, also überall lebt, sei es in Tel Aviv, Chicago oder Berlin). Das bedeutet sicherlich nicht, dass wir deswegen die zerstörerische Politik Israels bejahen müssen. Jedoch, das linksradikale Ethos des »Verrats«, das wir als Zeichen unserer moralischen Überlegenheit und individuellen Courage („nicht in meinem Namen!“) einzunehmen pflegen, sollten wir lieber entsagen und bereit sein es durch ein Ethos der Verbundenheit zu ersetzen. Verbundenheit zu den vielfältigen Gemeinschaften und Bevölkerungen, mit denen wir, trotz all unserer Illusionen und falschen Zuweisungen, unser Leben und unsere Welt teilen.
Übersetzt von Sebastian Landsberger, lingua•trans•fair
Eilat Maoz ist Doktorandin der Anthropologie an der University of Chicago. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Schnittstelle zwischen Polizei und politischer Ökonomie, insbesondere in kolonialen und postkolonialen Kontexten. Ihr erstes Buch, Inappropriate Acts: Law and Violence on Israel's Colonial Frontier, erscheint 2019 (Van Leer Institute, Jerusalem).
Weiterführende Links
Moishe Postone, Nationalsozialismus und Antisemitismus
Tsafrir Cohen, Die israelische Linke im Schatten
Download PDF



